Social Entrepreneurship als eine zeitgemäße Unternehmens-perspektive
Prof. Dr. Matthias Raith ist Inhaber des Lehrstuhls für Entrepreneurship an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Dort verbindet er seine Forschung und Lehre mit aktiver Unternehmensgestaltung und Gründungsbegleitung.
Neben seinem Interesse für Social Entrepreneurship begeistert er sich für strategische Unternehmensentscheidungen, Verhandlungsanalyse und Wirtschaftspolitik.
von Prof. Dr. Matthias Raith
Vor fast 30 Jahren haben Adam Brandenburger und Barry Nalebuff mit ihrem Bestseller-Buch „Co-opetition“ Management, Wissenschaft und Praxis eine neue Strategieperspektive gegeben: Unternehmenserfolg basiert nicht ausschließlich auf Vorteilen im Wettbewerb gegeneinander, wie in der traditionellen Managementliteratur propagiert, sondern vielmehr im Wettbewerb miteinander um gemeinsame Zielgruppen. Der Gedanke ist einfach, wenn man Wertschöpfung multidimensional betrachtet.
Der amerikanische Autobauer Ford hat zum Beispiel frühzeitig erkannt, dass man Autos leichter verkaufen kann, wenn man den KäuferInnen neben dem Auto selbst auch die dazugehörige Versicherung und Finanzierung anbietet. Der französische Reifenhersteller Michelin hat mit seinen renommierten Reise- und Restaurantführern Autofahrern Grund gegeben, mehr und weiter zu fahren, wofür sie auch mehr Reifen benötigen. Diese sich ergänzenden Wertschöpfungsansätze bezeichnet man als Komplementaritäten, die von einem Unternehmen allein oder auch von mehreren Unternehmen gemeinsam als Wertenetzwerk angeboten werden können. Mehr Wertschöpfung ermöglicht somit höheren wirtschaftlichen Unternehmenserfolg.
Welche gesellschaftliche Verantwortung Unternehmen haben
Von Unternehmen in der heutigen Gesellschaft wird mehr erwartet als die bloße Maximierung ihres wirtschaftlichen Erfolgs. Unternehmen sollen gesellschaftliche Verantwortung (Corporate Social Responsibility, kurz CSR) für soziale und ökologische Probleme übernehmen, da viele der drängendsten gesellschaftlichen Herausforderungen auch eine negative Folge globalisierter Marktwirtschaften sind.
Diese Verantwortung können Unternehmen auch komplementär in ihren Wertschöpfungsansatz integrieren. So wird ein Krombacher Bier für KundInnen interessanter, wenn man mit dem Kauf die Rettung des Regenwaldes unterstützt. Und auch ein Paket Pampers wirkt verlockender, wenn dadurch eine lebensnotwendige Impfung eines Kindes in Afrika finanziert wird. Durch derartige – für KundInnen wichtige Komplementaritäten – können Unternehmen mehr Geld verdienen, indem sie Gutes tun.
Ist CSR daher ausreichend, um all die sozialen, ökologischen und ökonomischen Herausforderungen zu bewältigen, die zum Beispiel in den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen dokumentiert sind? Da soziale und ökologische Wirkung nur schwer zu messen sind, ist man auf die Berichterstattung der Unternehmen angewiesen, denen jedoch oft Schönfärberei unter dem Stichwort Greenwashing vorgeworfen wird. Misstrauen ist durchaus gerechtfertigt, wenn das Gute lediglich Mittel zum Zweck des Geldverdienens ist.
Wie Unternehmen eine soziale und ökologische Mission nachhaltig durchführen
Ein Perspektivwechsel tut not, der in der gesellschaftlichen Verantwortung den eigentlichen Zweck sieht und Unternehmen gezielt Geld verdienen lässt, um Gutes tun zu können. Diesen Ansatz charakterisiert Social Entrepreneurship, bei dem ein Unternehmen als Mittel dient, um eine soziale oder ökologische Mission ökonomisch nachhaltig durchführen zu können. Um eine Mission aufrechterhalten zu können, muss ein Sozialunternehmen die erforderlichen Ressourcen bereitstellen können, wie jedes andere Unternehmen auch. Das erfordert keine Zauberei, nur die Identifikation und den Umgang mit Komplementaritäten, wie oben beschrieben. Auf diese Weise kann man Wälder retten oder neue Bäume pflanzen, indem man gewinnorientiert eine Internetsuchplattform wie Ecosia betreibt oder wie bei Beliya, Mädchen in Afrika ihre Schulbildung durch den Verkauf von Luxushandtaschen in Industrieländern finanziert.
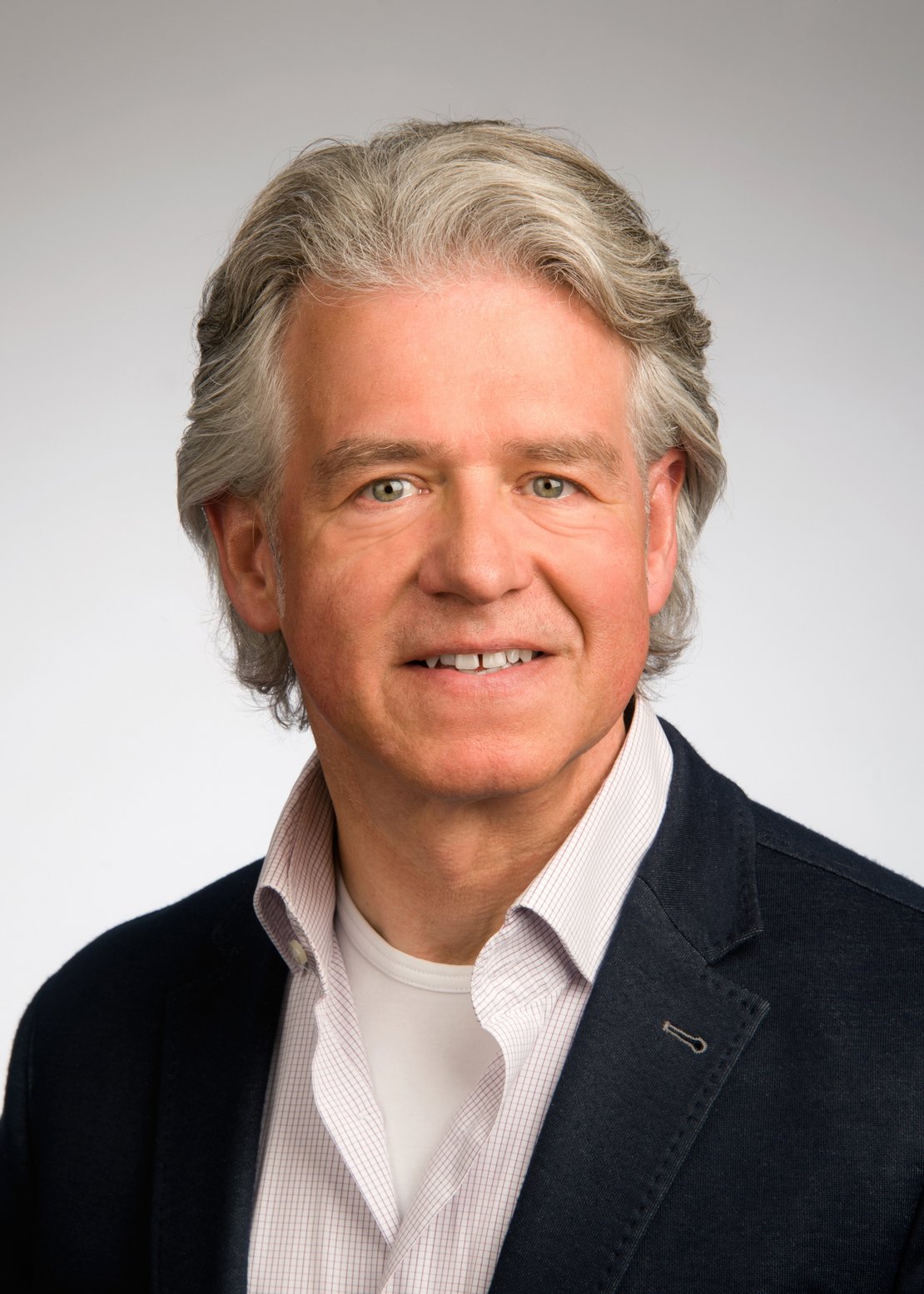
Der seit 2018 regelmäßig publizierte Deutsche Social Entrepreneurship Monitor (DSEM) – sowie auch der daraus 2020 entstandene und zuletzt in 21 europäischen Ländern durchgeführte European Social Enterprise Monitor (ESEM) – dokumentieren eindrucksvoll die Vielfalt ökologischer und sozialer Ziele, die von Social Entrepreneurs derzeit unternehmerisch verfolgt werden. Die Erhebungen zeigen hierbei eine Diversität der Einnahmearten, sei es durch Umsätze am Markt oder durch unterschiedliche Fundingansätze, bei denen Geldgeber oder Freiwillige die Mission direkt unterstützen. Es handelt sich mehrheitlich um jüngere Unternehmen, ins Leben gerufen durch eine neue Generation von GründerInnen, die den Perspektivwechsel zum Unternehmen als Mittel vollzogen haben.
Steht Social Entrepreneurship in Konkurrenz zu CSR?
Ob diese neuen Unternehmen die drängenden gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft besser meistern können als traditionelle, vorrangig gewinnorientierte Unternehmen oder als der Staat selbst, bleibt abzuwarten. Die missionsorientierte Unternehmensperspektive überzeugt jedenfalls mit ihrer Glaubwürdigkeit im Umgang mit gesellschaftlicher Herausforderung. Für sie trifft auch zu, dass sie dem Zeitgeist einer jungen Generation entspricht, die der gesellschaftlichen Verantwortung klassischer Unternehmen misstraut, wie auch der meist in Wahlzyklen agierenden Politik.
Es wäre grundlegend falsch, Social Entrepreneurship als Konkurrenz zu CSR zu sehen. Auch hier ist es angebracht, in Komplementaritäten zu denken: die neuen Sozialunternehmen können in gemeinsamen Wertenetzwerken der gesellschaftlichen Verantwortung traditioneller Unternehmen zu mehr Glaubwürdigkeit verhelfen. Somit stellt Social Entrepreneurship eine zeitgemäße Unternehmensperspektive im Umgang mit Komplementaritäten dar.
